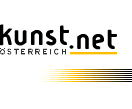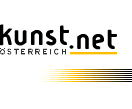|
In dieser Ausstellung stellen sich zum ersten Mal in Wien junge
Künstlerinnen vor, die im November 2000 von der Kuratorin Emese
Süvecz in Budapest zusammengeführt wurden:
Szilvia Reischl
In ihrem „Curriculum Vitae“ verleiht die ungarische Künstlerin
dem Reisen per Anhalter einen besonderen Stellenwert. 1989 legte
sie 6000 km mit 72 Autos in 6 Wochen zusammen mit ihrer Schwester
zurück. Seither wird die Liste der von ihr besuchten Länder
immer größer. Dementsprechend wird die Zahl der von ihr
mit Bedauern noch nicht besuchten Länder („for example
Transylvania“) kleiner. Hauptsächlich aber lebt und arbeitet
die Künstlerin in Budapest, die Ausbildung erhielt sie dort
von 1994 - 2000 in der Medienklasse der Akademie der Bildenden Künste.
Ihre künstlerische Arbeit kann als persönlich, humorvoll,
assoziativ beschrieben werden. In ihren Installationen, Malerei
und Fotografie spielt die Künstlerin mit Text und Bedeutung.
Auf vielfältige Weise die Strategien der Repräsentation
und Interpretation hinterfragend schafft sie mit ihren subjektiven
Assoziationen flexible, metamorphe Strukturen. Einschränkungen
versucht sie zu vermeiden und mit Humor zu durchbrechen. Damit und
mit der Thematisierung der eigenen Rolle („personal/female“)
zielt Szilvia Reischl auf eine unabhängige Position in der
aktuellen ungarischen Kunst.
PP Group: Katarina Sevic and Zita Majoros
Der zweite Teil der Ausstellung widmet sich einer Gruppe von zwei
Künstlerinnen: beide sind in Novi Sad (YU) geboren, haben an
der dortigen Akademie die Graphikklasse besucht und in Budapest
2001 die Medienklasse. Ihre Arbeit kann in die Nähe der Konzeptkunst
gerückt werden. Der Fokus der PP Group (Plan Pet Group) liegt
auf den Prozessen der Entstehung, der Vermittlung und der Rezeption
von Kunst. Im Mittelpunkt stehen die Methoden der visuellen Kommunikation:
beispielsweise jene von KünstlerInnen, welche die PP Group
noch durch ein „Art Users Manual“ ergänzt. Verschiedene
Piktogramme bieten darin eine Anleitung für die Rezeption eines
Kunstwerks, ausgehend von der Beobachtung oft unüberwindbar
wirkender Barrieren zwischen RezipientInnen und Kunstwerk. Als eine
Notwendigkeit erscheint den Künstlerinnen deswegen ihr Konzept,
das ein Erklärungsmodell für Verhalten, Wahrnehmung und
(emotionale) Reaktion entwickelt.
|


|